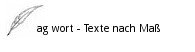Während geschlossene Spielhallen bei Spielsüchtigen in Thüringen für eine Verschnaufpause sorgen, warnen Experten von Langzeitfolgen. Vor allem Mediensucht und „pathologisches Computerspielen“ könnte zunehmen.
Erfurt. Die Coronakrise hat zumindest für die Betroffenen von Spielsucht positive Auswirkungen. „Die meisten Spieler an Geldspielautomaten nehmen die Schließung von Spielhallen als Befreiung wahr“, erklärt Claudia Frisch von der Thüringer Fachstelle Glücksspielsucht. Kaum einer der Betroffenen weiche auf entsprechende Angebote im Internet aus. Ob dieser Effekt auch nach dem Ende des Lockdowns anhalte, könne noch nicht bewertet werden.
Insgesamt wird die Zahl der Glücksspielsüchtigen im Freistaat auf 11.000 geschätzt. Rund 83 Prozent der Hilfesuchenden in diesem Bereich wenden sich Frisch zufolge wegen einer Spielgeräte-Sucht an die Beratungsstellen. Während die jährliche Umfrage der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung bis 2017 lange Zeit ein fallenden Trend bei der Spielsucht verzeichnet habe, seien die Zahlen 2019 erstmals wieder leicht angestiegen. Das Einstiegsalter sank von durchschnittlich 30 auf 25 Jahre.
Der Bereich, in dem Experten durch die Coronakrise und die Lockdowns hingegen deutliche Steigerungen befürchten, sind verschiedene Bereiche der „nichtstofflichen“ Süchte, die an keine abhängig machende Substanz gekoppelt sind. Neben dem pathologischen Computerspielen kann dazu auch eine allgemeine Mediensucht, Handy- oder Shoppingsucht zählen, erklärt Sebastian Weiske, Koordinator bei der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen. Weil im Lockdown Alternativen fehlten, verlagerten sich derzeit viele Aktivitäten auf den virtuellen Raum. „Darunter sind sicher auch Fälle, die bedrohlich für die Entwicklung einer Sucht sind.“
Aktuell könne dieser Trend zwar noch nicht durch Zahlen belegt werden, das sei jedoch nicht ungewöhnlich: Bis die negativen Folgen einer solchen Sucht sichtbar und der Leidensdruck der Betroffenen so hoch werde, dass diese sich Hilfesuchend an eine Beratungsstelle wendeten, könnten zwei bis drei Jahre vergehen. „Wir erwarten aber in den kommenden Jahren definitiv einen Anstieg bei den nichtstofflich gebundenen Süchten.“
Besonders tückisch an dieser Form der Sucht ist der fließende Übergang zwischen einer „schlechten Angewohnheit“ und einer echten Dysfunktionalität. „Ob Handy, Medien, Sport oder Arbeit: im Prinzip kann fast jede Verhaltensweise zu einer Sucht führen.“ Hinweise auf ein mögliches Problem seien Gereiztheit oder impulsives Verhalten bei „Entzug“ des jeweiligen Suchtmediums oder die Vernachlässigung von sozialen Kontakten. Auch durch die Sucht verursachter Arbeitsplatzverlust oder finanzielle Probleme könnten ein Zeichen sein. Doch es gebe auch Rezepte, um eine Suchtentwicklung zu verhindern: Vor allem Regeln und Strukturen seien besonders wichtig. „Auch während des Lockdowns sollte sich jeder seinen Tag strukturieren, wie gewohnt früh aufstehen und soziale Kontakte aufrecht erhalten – etwa über Videotelefonie.“
Kaufsüchtige könnten sich wöchentlich finanzielle Limits setzen, die nicht überschritten werden. Bei Handy- und Spielsucht könnten zeitliche Rahmen gesetzt werden.
Für die Therapie von Süchtigen allgemein bringt der Lockdown indes unterschiedlich harte Einschnitte, erklärt Weiske. „Prekär ist die Situation derzeit vor allem bei Selbsthilfegruppen.“ Die meisten Gruppen könnten sich derzeit überhaupt nicht treffen, es fehle vor allem an geeigneten Räumlichkeiten. Die ambulanten Beratungsstellen seien mit dem zweiten Lockdown besser zurechtgekommen als im März, allerdings sei die Arbeitsbelastung deutlich höher als in normalen Zeiten. In der klinischen und Reha-Betreuung gebe es Aufnahmestopps oder Einschränkungen bei der Aufnahme, weil die Kliniken Corona-Betten vorhielten.
Andreas Göbel für dpa